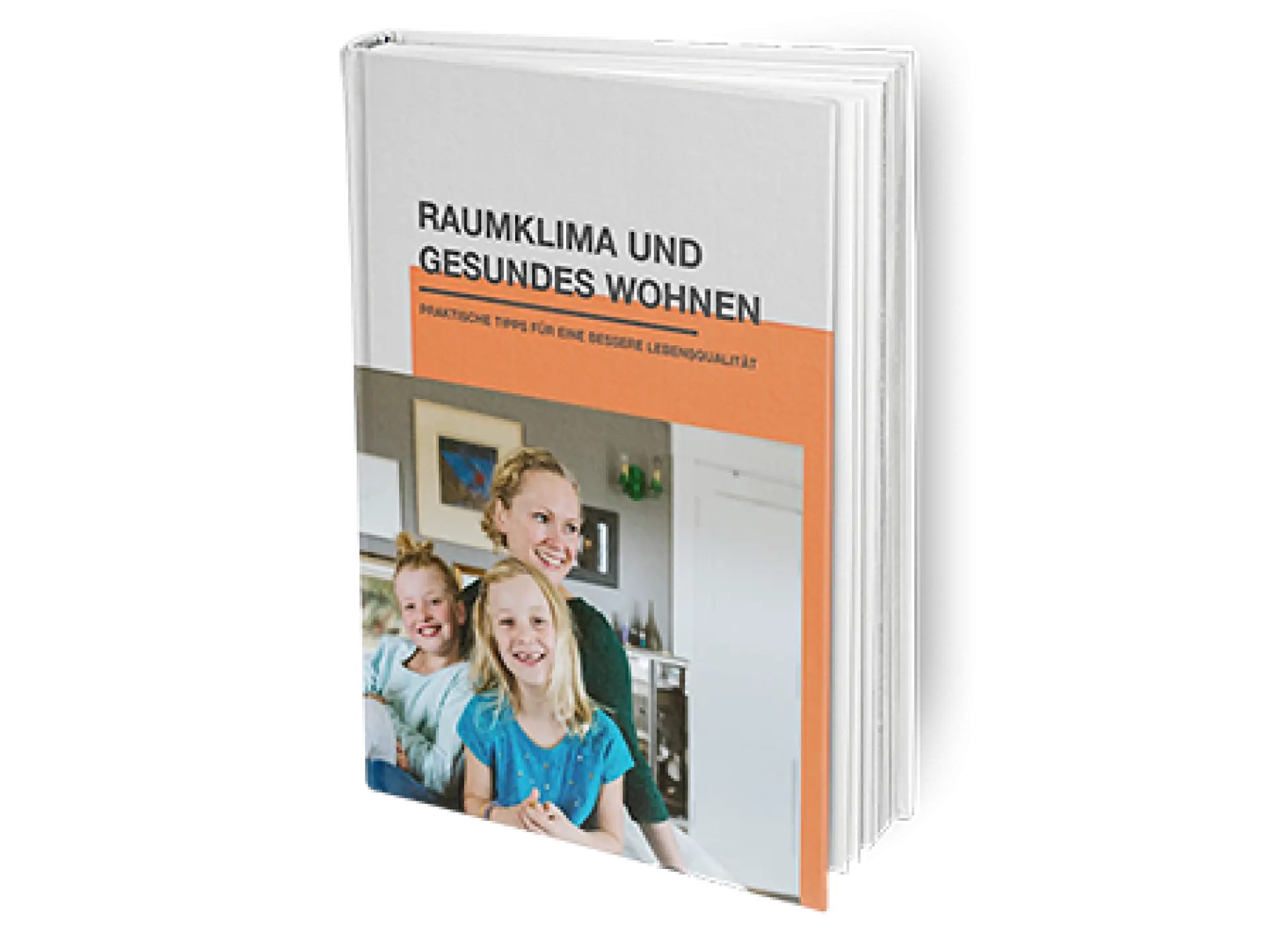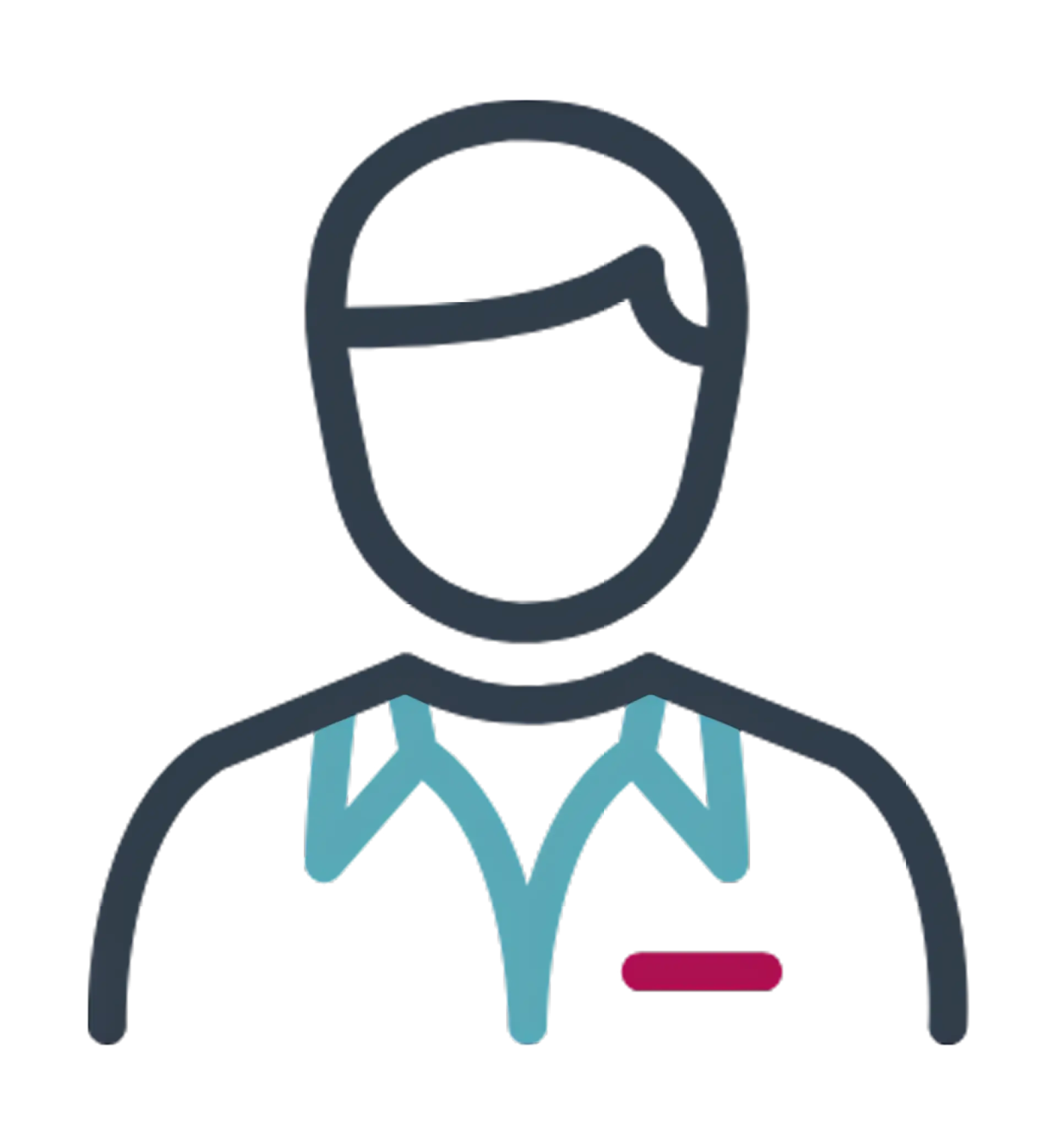Sie kennen es bestimmt. Draußen ist es kalt und ungemütlich. Also drehen Sie die Heizung auf und sorgen so für angenehme Temperaturen – sei es zuhause oder in Büroräumen. Doch die warme Heizungsluft ist anders als die warme, frische Luft eines Sommerabends. Das merken auch unsere Schleimhäute, Haustiere und sogar Möbel. Daher sollten Sie auf ein gutes Raumklima achten und allzu trockene Heizungsluft verhindern, um Symptome und spätere Gesundheitsschäden zu vermeiden.
Trockene Heizungsluft: Symptome vermeiden und bekämpfen

Was heißt „trockene Luft“ genau?
Rein physikalisch ist damit der Wassergehalt der Luft gemeint. Diese Luftfeuchtigkeit können Sie ganz einfach selbst messen. Für kleines Geld sind entsprechende Messgeräte (Hygrometer) im Handel erhältlich. Viele moderne Wetterstationen haben ein solches Hygrometer bereits integriert.
Neben der messbaren Luftfeuchtigkeit spüren Sie auch während des Atmens, ob die Luft eher trocken oder feucht ist:
Ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch (zum Beispiel im Regenwald), ist das Atmen unangenehm und die Luft erscheint dick und zäh.
Sehr trockene Luft (zum Beispiel in der Wüste) erschwert ebenfalls das Atmen.
Grundsätzlich ist ein gesundes Mittel zwischen 40 und 60% Luftfeuchtigkeit empfehlenswert. Zur Entstehung von trockener Luft und Gegenmaßnahmen erfahren Sie mehr in unserem Artikel „Heizungsluft: Wie kommt die unangenehme Luft zustande und was kann ich tun?“.
Symptome trockener Heizungsluft
Zu trockene Heizungsluft greift die Gesundheit Ihres ganzen Körpers an und sorgt für ein unangenehmes Raumklima. Allerdings bemerken wir das oft gar nicht oder bringen gewisse Symptome nicht mit der richtigen Ursache, der zu trockenen Luft, in Verbindung.
Auswirkungen auf die Atemwege
Ihre Atemwege sind mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Atmen wir durch die Nase, sorgen die Nasenhaare dafür, dass grobe Schmutzpartikel und Staub aus der Luft gefiltert werden. Außerdem gibt die Schleimhaut – wie der Name schon sagt – kontinuierlich Schleim ab. Dieser sorgt dafür, dass Schleimhäute nicht austrocknen. Und er enthält Stoffe, die Bakterien und Viren abtöten, die wir einatmen.
Die Schleimhaut ist außerdem dafür verantwortlich, die Luft bereits beim Eintritt in den Körper anzufeuchten und zu erwärmen. Nur so können wir auch bei kalten Temperaturen normal atmen und überleben. Die Schleimhaut stellt also in vielerlei Hinsicht eine Art Schutzbarriere dar.
Folgen für Tiere und Möbel
Prinzipiell unterscheiden sich die gesundheitlichen Auswirkungen auf Tiere nicht von denen der Menschen. Auch bei den Tieren sind es vor allem die Atemwege, die angegriffen werden. Allerdings sind die Folgen häufig schlimmer und treten schneller ein als beim Menschen.